Hervorgehoben:Autorin
Michaela Marty, Freiwillige von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen
Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2024 "Anders zusammen" erarbeitet. Die Gründung des gemischtkonfessionellen Kantons Aargau im Jahr 1803 brachte Katholiken und Protestanten erstmals unter ein gemeinsames Dach und schuf damit den Nährboden für neue Spannungen zwischen Kirche und Staat. Dieser Beitrag ist der zweite Teil einer zweiteiligen Serie, die das spannungsreiche Zusammenleben dieser beiden Konfessionen beleuchtet.
Als Reaktion auf die Aargauer Klosteraufhebung berief der Kanton Luzern die umstrittenen Jesuiten an seine höheren Schulen und stärkte so die Stellung der Kirche in der Bildung. 1844-1845 überstürzten sich die Ereignisse mit zwei liberalen Freischarenzügen gegen das konservative Luzern, an denen sich auch Aargauer beteiligten und die in einem Debakel endeten. Sie gipfelten am 20.07.1845 in einem der seltenen politischen Attentate in der Schweizer Geschichte, nämlich der Ermordung von Josef Leu, Luzerner Katholikenführer und Urvater der CVP.
Ende 1845 schlossen sich die katholisch-konservativen Kantone der Zentralschweiz sowie das Wallis und Freiburg zu einem Sonderbund zusammen. 1847 beschloss die radikal-liberale Mehrheit der Tagsatzung die Auflösung des Sonderbunds und die Ausweisung der Jesuiten aus der Schweiz. Mit dem Angriff gegen das Tessin begann am 03.11.1847 der letzte Bürgerkrieg auf Schweizer Boden, der 25 Tage dauerte und dem 93 Soldaten zum Opfer fielen. Auch Aargauer nahmen auf der Seite der Tagsatzungstruppen an den Kämpfen teil. Sie endeten mit dem Sieg der liberalen Seite.
Nach dem Krieg bekam die Schweiz 1848 ihre erste Verfassung, die der Aargau mit 70 Prozent Ja-Stimmen annahm, sowie eine übergeordnete Regierung und eine Bundeshauptstadt. Der Jesuitenorden wurde verboten. Trotz eines Bürgerkriegs mit eindeutigen Siegern und Verlierern war die Bundesverfassung ein Kompromiss, der den Sonderbundskantonen in wesentlichen Punkten entgegenkam und ihre Integration in den Bundesstaat vereinfachte. Dazu zählen die Betonung der Kantonssouveränität (Föderalismus) u. a. im Schulwesen und in der Kirche, das Ständemehr und der Ständerat als Vertretung der Kantone. Nur vereint sollte es den ursprünglichen Gegnern des Kulturkampfes gelingen, die Eidgenossenschaft vor der Einflussnahme fremder Mächte zu schützen, die während des Sonderbundkriegs gedroht hat.
1870 verschärfte sich der Kulturkampf aufgrund der päpstlichen Unfehlbarkeitserklärung. Zusammen mit anderen Kantonen trat der Aargau daraufhin aus dem Bistum Basel aus, dessen Bischof abgesetzt wurde. Als Zeichen des Widerstands ergriffen katholische Aargauer mehrmals erfolgreich das Referendum gegen die Staatssteuern, was den Kanton in eine schwierige finanzielle Lage brachte. 1884 wurde der Konflikt mit dem Bistum Basel wieder beigelegt.
Der Kulturkampf spaltete den Schweizer Katholizismus in eine konservative Mehrheit, die sich immer noch benachteiligt fühlte, und in eine Minderheit liberaler Katholiken, zu denen Augustin Keller zählte und die führenden Positionen in Bern übernahmen. Die reformkatholische Identität setzte sich aus einer klosterfeindlichen Haltung und einer Jesuitenfeindlichkeit zusammen. Der Jesuitenorden war direkt dem Papst unterstellt und eng mit den restaurativen Kräften in Europa verbunden. Er kämpfte an vorderster Front gegen die Reformation und den Liberalismus resp. für eine hierarchische Kirche.
Dass die Konfessionsartikel ihren Weg in die revidierte Bundesverfassung von 1874 fanden, war ein wesentliches Verdienst von Augustin Keller. Unter dem Einfluss des Kulturkampfs richteten sich drei Bestimmungen im Besonderen gegen die katholische Kirche. Ein neues Bistum durfte nur gegründet werden, falls der Bund dem zustimmte (Art. 50). Art. 51 beinhaltete ein gesamtschweizerisches Jesuitenverbot, während Art. 52 die Gründung neuer Klöster oder religiöser Orden untersagte.
Art. 27 betraf die Bildung, welche "entkonfessionalisiert" resp. verstaatlicht wurde. Die Kantone hätten sicherzustellen, dass die Primarschulen öffentlich, kostenlos und überkonfessionell sind sowie von einer zivilen Behörde geleitet werden. Der Glaube stand von nun an nicht mehr über dem Wissen. Dieses Dogma der Aufklärung war einer der Hauptstreitpunkte des 19. Jahrhunderts. Im Aargau wurden die Klosterschulen bereits 1835 per Dekret aufgehoben.
Erst nach dem Klosterstreit (1841-1843) und der Gründung des Bundesstaates 1848 wurde allmählich aus einer Vorherrschaft des Staats über die Kirche (Staatskirchentum) ein partnerschaftliches Verhältnis (Landeskirchentum), welches die revidierte Kantonsverfassung 1885 offiziell besiegelte. Indem man in den Kirchenartikeln den Katholisch-Konservativen grösstenteils entgegenkommen ist, zeigte sich das Bemühen nach Versöhnung mit dem Katholizismus, der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts national wie auch kantonal immer wieder auf der Verliererseite wiederfand. Nach Jahren des harten Kulturkampfs kam der noch junge Kanton Aargau endlich zur Ruhe, da sich die Fronten zwischen Konservativen und Liberal-Radikalen glätteten.
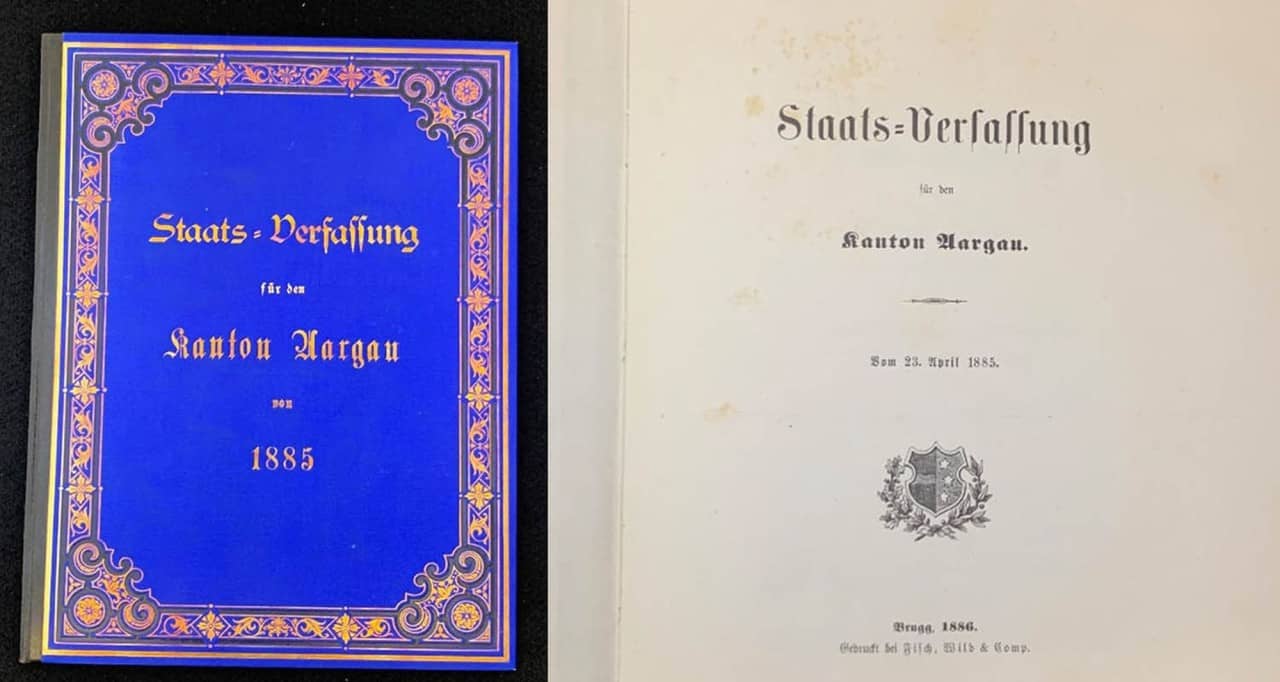
Die katholisch-konservative Seite soll neu auf höchster politischer Ebene, dem Regierungsrat, Einsitz nehmen (Art. 37). Als Landeskirchen, die nach demokratischen Grundsätzen organisiert sind, anerkennt der Aargau die drei christlichen Religionsgemeinschaften der Christkatholiken, Protestanten und Katholiken. Diese dürfen Steuern erheben (Art. 67), kantonale Kirchenversammlungen (Synoden) wählen und ihre Geschäfte unter Aufsicht autonom regeln (Art. 68). Damit wurde eine klare Entflechtung zwischen Kirche und Kanton vorgenommen. Art. 70 bestimmte weiter, die noch in Händen des Kantons befindlichen Pfrund- und Kirchengüter seien den Kirchgemeinden zurückzuerstatten. Von nun an verhält sich der Kanton konfessionell neutral, was zu einer spürbaren Befriedung der kirchenpolitisch angespannten Situation im Aargau des 19. Jahrhundert geführt hat.
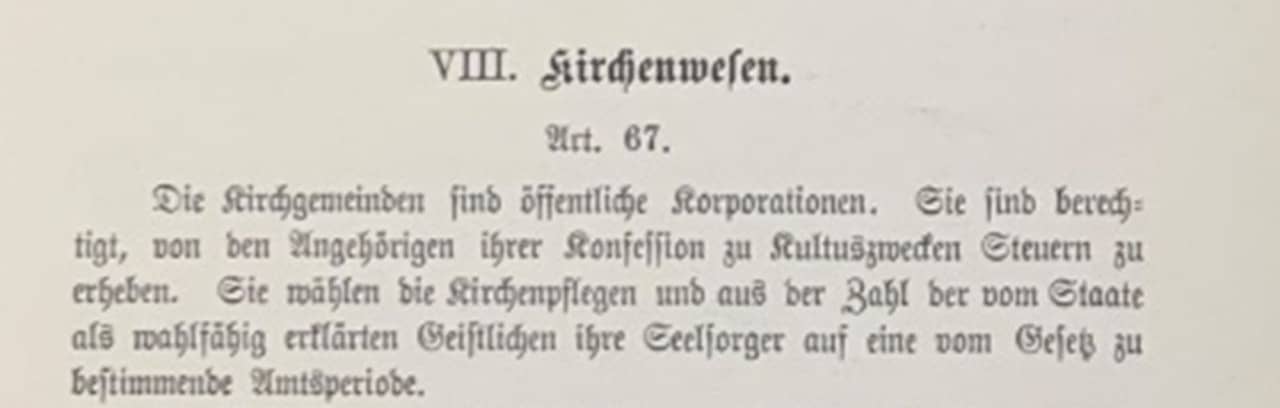
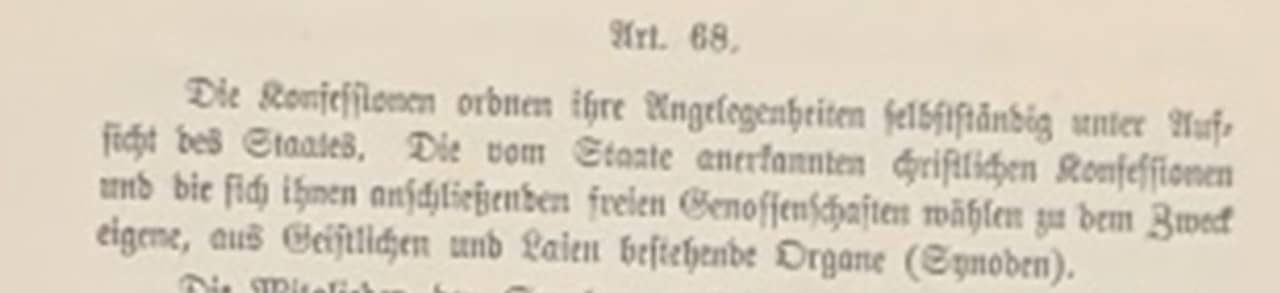
Michaela Marty, Freiwillige von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen